Was gedacht werden kann, wird auch gemacht
Was bedeutet es für die Lieferanten, für die Gartenbaubetriebe, wenn große Handelsunternehmen immer stärker auf die Einhaltung von Nachhaltigkeitskriterien setzen? Am Beispiel von Pflanzen Kölle, mit bundesweit 13 Gartencentern ein bedeutender „Spieler" in der Branche, lässt sich darstellen, was für Lieferanten-Anforderungen ein ausgefeiltes Nachhaltigkeitskonzept mit sich bringt.
- Veröffentlicht am

Antworten geben Michael Wittmann, in der Geschäftsführung für Einkauf, Logistik und Bio-Gärtnerei zuständig, und Ulrike Rothhaar, die als Assistentin der Geschäftsführung die Bereichsleitung für Nachhaltigkeit innehat.
DEGA GARTENBAU: In einer Presseinformation hat die Baumarktkette „toom" kürzlich eine Zusammenarbeit mit der Umweltschutzorganisation GLOBAL 2000 angekündigt. Angestrebt wird unter anderem, dass die Pflanzenschutzbelastung bei „Nützlingsfreunden" unter den Pflanzen geprüft und reduziert wird. Die Rede war davon, dass die Testergebnisse über Zulassung oder Auslistung entscheiden würden. Müssen Gartenbaubetriebe damit rechnen, dass zukünftig Nachhaltigkeitskriterien darüber entscheiden werden, ob der Daumen nach oben oder nach unten zeigt?
Michael Wittmann: Wir können natürlich nicht für „toom" sprechen, aber bei Pflanzen Kölle spielen Nachhaltigkeitsfragen schon lange eine wichtige Rolle in der Unternehmenspolitik. Mit dem Thema der Pestizidreduzierung beschäftigen wir uns intensiv seit dem Jahr 2013 in Projekten mit den Lieferanten. Seit 2015 haben wir eine Negativliste zu besonders schädlichen Wirkstoffen, seit 2018 kooperieren wir als erstes Gartencenter in Deutschland mit GLOBAL 2000 im Pestizidreduzierungsprogramm, dessen Basis ein Grenzwertkatalog ist. Unser Bio-Projekt läuft sogar schon seit 2008. Natürlich spielen diese Aspekte auch eine Rolle beim Einkauf. Für die Gärtner bedeutet das: Um den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln zu reduzieren, muss die Kulturführung angepasst werden, gerade bei mehrjährigen Kulturen. Es gibt Wirkstoffe, die auch lange nach der Verwendung noch nachweisbar sind. Die Bewertung läuft nicht so einfach mit Daumen hoch oder runter, es gibt einen ständigen Dialog mit den Gärtnern, eine Entwicklung muss erkennbar sein.
Ulrike Rothhaar: Unser Nachhaltigkeitskonzept basiert auf vier Themensäulen. Das sind die nachhaltigen Sortimente, Ressourcen und Klimaschutz, Lebensraum und Artenvielfalt sowie Fairness und Transparenz. Darunter sortieren sich viele Einzelthemen, neben dem Pflanzenschutz und den Bio-Produkten auch Wasser, Abfallrecycling, Torf, Verpackungen, Artenvielfalt, Regionalität und einiges mehr. Vieles spielt zusammen und es kommt darauf an, die roten Fäden zu verbinden. Es müssen konkrete Ziele formuliert und erreicht werden, dazu müssen die Verantwortlichen und ihre Kompetenzen definiert sein.
DEGA GARTENBAU: Hat sich Ihr Nachhaltigkeitskonzept in den vergangenen Jahren aus sich heraus selbst entwickelt – oder wie wurden die Schwerpunkte definiert?
Ulrike Rothhaar: Die Entwicklung war ein laufender Prozess. Wenn man sich mit solchen Fragen beschäftigt, wird Schritt für Schritt klar, dass und wie die Dinge zusammenhängen. Wir haben aber auch Hilfe von außen in Anspruch genommen, um die Dinge nicht nur durch die spezielle Kölle-Brille zu betrachten.
DEGA GARTENBAU: Was müssen denn der Gartenbau und andere Branchenlieferanten zukünftig erwarten? Welche Anforderungen sehen Sie in den nächsten Jahren?
Michael Wittmann: Pestizide werden eine zentrale Rolle spielen, die Faustformel wird lauten: Je weniger, desto besser. Oder bezogen auf die konventionelle Produktion: Je mehr Nützlingseinsatz, desto besser. Das Thema steht im direkten Zusammenhang mit dem Erhalt der Artenvielfalt, ein Aspekt, der in kurzer Zeit an Bedeutung noch weiter zunehmen wird. Und die Verwendung von Kunststoff im Gartenbau ist eine weitere aktuelle und zentrale Frage.
Ulrike Rothhaar: An der Plastikfrage zeigt sich für mich beispielhaft, dass man vieles erreichen kann. Wir verwenden in unserem Bio-Kräuter-Segment schon länger recycelbare PCR-Pflanztöpfe und wünschen uns natürlich auch von unseren Lieferanten solche Produkte.
DEGA GARTENBAU: Beim Stichwort Plastikverbrauch in der Branche spielen seit einigen Jahren die Einweg-Wasserpaletten, von denen Jahr für Jahr bis zu 90 Millionen Stück allein aus Holland auf den deutschen Markt kommen, in der Diskussion eine große Rolle. Wie geht man bei Pflanzen Kölle mit dem Thema um?
Michael Wittmann: Von unseren Hauptlieferanten erhalten wird die Pflanzen in Mehrwegtrays, in den Niederlanden als Floratinos, in Deutschland als Palettinos bekannt. Unsere Quote dürfte bei rund 80 Prozent liegen. An solchen klassischen Kreislaufsystemen führt kein Weg vorbei, das müssen auch die Lieferanten aus dem Gartenbau erkennen. Der Anteil an Plastikverpackungen, zu denen die Einwegtrays gehören, hat sich in Deutschland in nur 20 Jahren verdoppelt. Auf europäischer Ebene wird noch in diesem Jahr eine verbindliche Wiederverwertungsquote für Transportverpackungen angestrebt. Das ist ein Fingerzeig auf die zukünftige Entwicklung. Wenn die Erfüllung von Nachhaltigkeitskriterien von der Wirtschaft nicht realisiert wird, dann folgen Vorgaben von außen, von politischer Seite.
Ulrike Rothhaar: Wir werden den Anteil an Mehrwegtrays sicher noch erhöhen können. Das System ist auch für uns gerade in der Saison mit etwas Aufwand verbunden. Aber es ist machbar, alle Beteiligten sind gut eingespielt. Die Pflanzen werden geliefert und kommen auf die Präsentationstische, die Mehrwegtrays werden in der Anzahl dokumentiert, gesammelt und von den Lieferanten, denen sie gehören, wieder mitgenommen.
DEGA GARTENBAU: Pflanzen-Kölle wird nicht nur beliefert, Sie produzieren auch selbst. Welche Rolle spielt die Eigenproduktion in dem Nachhaltigkeitskonzept, was produzieren Sie in welcher Größenordnung?
Michael Wittmann: Unsere Kräuterproduktion in München wird im nächsten Jahr zu 100 Prozent Bio-Produkte liefern, unsere Staudengärtnerei in Heilbronn erreicht in der Fläche gegenwärtig einen 50-prozentigen Bio-Anteil. Weitere Flächen bei Stauden und Baumschulartikeln sind in der Umstellung auf Bio. Etwa 45 Prozent der Pflanzen aus unseren Gärtnereien werden nach ökologischen Richtlinien kultiviert. Ziel ist es, bis 2025 80 Prozent zu erreichen – wenn möglich sollen sie das EU-Bio-Siegel tragen. Die bei uns vermarkteten Rosen stammen zu 99 Prozent aus der Eigenproduktion. Bezogen auf die Nachhaltigkeitsfragen können wir in der eigenen Gärtnerei in vielen Fällen zunächst einmal testen, ob das, was wir wollen, auch machbar ist. Erst danach sprechen wir mit den Lieferanten. Bei uns hat die Umstellung auf recycelbare Pflanztöpfe aus PCR-Kunststoff eineinhalb Jahre gedauert. So etwas sollte man wissen, bevor man mit Lieferanten verhandelt.
DEGA GARTENBAU: Ein Kräuterangebot zu 100 Prozent in Bio – das leuchtet ein, schließlich verzehrt man die Kräuter. Aber hat das Thema im Zierpflanzenbereich wirklich Zukunft?
Ulrike Rothhaar: Wir glauben ja, weil mit einer Bio-Zertifizierung Standards gesetzt werden. Es gibt sogar im Beet- und Balkon-Segment entsprechende Kundennachfragen.
Michael Wittmann: In diesem Bereich zeigt sich wieder beispielhaft, wie die Dinge zusammenhängen. Bio ist ja nicht nur für Menschen relevant, sondern ebenfalls für Insekten, etwa Bienen. Die Kundennachfrage nach bienenrelevanten Pflanzen steigt kontinuierlich. Blühende Kräuter, die noch vor ganz wenigen Jahren überhaupt keine Rolle spielten, sind heute bei den Konsumenten heißbegehrt. Etwa Strauchbasilikum – eine vorzügliche Bienenweide, die im Garten auch noch ganz toll aussieht.
DEGA GARTENBAU: Kräuter in Bio-Qualität – ist das auch preislich relevant, sind Ihre Kunden bereit, dies zu honorieren? Immerhin gelten die deutschen Verbraucher im europäischen Vergleich als besonders preisaffin.
Michael Wittmann: Wir haben die Bio-Kräuter anfangs preisidentisch angeboten. Mittlerweile können wir auch leicht höhere Preise verlangen. Man darf das aber nicht zu weit ausdehnen. Das Bewusstsein, dass nachhaltig hergestellte Produkte mehr Geld kosten müssen, ist eindeutig gestiegen. Die Preisfrage wird dadurch aber nicht negiert.
DEGA GARTENBAU: Der Begriff Nachhaltigkeit stammt bekanntlich ursprünglich aus der Forstwirtschaft, er wird aber heute sehr viel breiter definiert. Bezogen auf die damit verbundene CO2-Frage spielen Nähe und Ferne, also die Transportwege, eine wesentliche Rolle. Welche Chancen ergeben sich für den deutschen Gartenbau daraus, welche Bedeutung hat Regionalität?
Ulrike Rothhaar: Im Umfeld unserer Gartencenter spielt Regionalität eine große Rolle, es gibt eine Bevorzugung heimischer Produktion, gerne würden wir dies ausbauen.
Michael Wittmann: Ja, das stimmt. Man darf aber nicht vergessen, dass der regional orientierte deutsche Gartenbau kaum die Mengen produzieren kann, die der Markt benötigt. Kurze Transportwege sind wichtig, man muss diese Frage aber auch immer mit den anderen Aspekten unseres Nachhaltigkeitskonzeptes in Einklang bringen. Grundsätzlich gilt: regionale Gärtner, willkommen!
DEGA GARTENBAU: Nachhaltigkeit wird in der Branche zumeist mit Blumen und Pflanzen in Verbindung gebracht. Nun ist aber bekannt, dass Pflanzen Kölle bedeutende Umsätze auch mit Gartenmöbeln macht. Und die kommen in der Regel aus Ländern Ost- oder Süd-Ost-Asiens. Da kann man wohl kaum von Regionalität sprechen.
Michael Wittmann: Stimmt. Aber wir müssen auch anerkennen, dass die Lieferanten in Asien Nachhaltigkeitskriterien ebenfalls beachten – und zwar immer mehr. Wir arbeiten beispielsweise mit einem sehr zuverlässigen chinesischen Lieferanten zusammen, der in solchen Fragen, etwa was die Verpackung angeht, sehr offen ist. Zudem arbeiten wir an Alternativen.
DEGA GARTENBAU: Gibt es in diesen Bereichen denn überhaupt Alternativen? Können Sie ein Beispiel nennen?
Michael Wittmann: Ja, wir arbeiten beispielsweise nun mit einem Unternehmen aus Serbien und Bosnien zusammen, geliefert werden Polsterauflagen für Gartenmöbel. Die kamen zuvor aus Vietnam. Oder auch Campingmöbel: Früher kamen bedeutende Größenordnungen aus China, heute aus Europa. Diese Entwicklung wird aber auch durch externe Aspekte gelenkt. Die Transportkosten liegen in dem Bereich vier bis fünf Mal höher als vor der Corona-Pandemie. Berücksichtigt werden müssen ebenfalls die Vorlaufzeiten von bis zu einem Jahr. In dem Bereich wird sich noch viel tun – in welche Richtung es gehen wird, ist heute kaum abzuschätzen.
Ulrike Rothhaar: Die Corona-Pandemie hat vieles durcheinander gewirbelt. Wir können aber sagen: Vorher konnten wir das Container-Volumen schon um rund zehn Prozent verringern.
DEGA GARTENBAU: Ihr Nachhaltigkeitskonzept stellt immer wieder neue Herausforderungen an Ihre Lieferanten, an die Gärtner. Wie erfahren diese das, wie kommunizieren Sie?
Ulrike Rothhaar: Es gibt ständige Gespräche, der Nachhaltigkeitsgedanke wird von unserem Team nach außen getragen – in Richtung Lieferanten und in Richtung Kunden. Zudem gibt es einmal jährlich einen Lieferantentag, an dem wir uns mit unseren wichtigsten Partnern austauschen.
Michael Wittmann: Auf dem Lieferantentag möchten wir unter anderem auch auf das Nachhaltigkeitsthema Torf eingehen. Wir arbeiten seit 2014 intensiv an einer Umstellung von torfhaltig zu torfreduziert – um schließlich torffrei möglich zu machen, ohne dabei die Qualität zu verlieren. Unsere gärtnerischen Erfahrungen und die Ergebnisse aus Lehr- und Versuchsanstalten spielen bei der Entwicklung die entscheidenden Rollen. Neue Rezepturen werden in unseren eigenen Gärtnereien, in unabhängigen Instituten und dem Lehr- und Versuchsbetrieb Stuttgart-Hohenheim getestet. Unser Ziel ist es, dass unser Erden-Sortiment bis 2022 zu 80 Prozent aus torffreien Erden besteht.
DEGA GARTENBAU: Mit was müssen die Gärtner, Ihre Lieferanten insgesamt rechnen: Wird die Fokussierung auf die Nachhaltigkeit bleiben oder sogar zunehmen? Oder wird das Ganze wieder weitgehend verschwinden, wenn andere ökonomische Aspekte sich in den Vordergrund schieben?
Michael Wittmann: Wird die digitale Revolution wieder verschwinden? Nein, sicher nicht. Frank Schirrmacher, der früh verstorbene Herausgeber der F.A.Z., hat einmal sinngemäß geschrieben: Alles was gedacht werden kann, wird auch gemacht. Eine an Nachhaltigkeitskriterien festgemachte Ökonomie ist denkbar, also auch machbar. Es gibt ja auch keine Alternative – es sei denn, wir wünschen, dass sich die Menschheit abschafft.
Das Gespräch führte Martin Hein, Hamburg.
Barrierefreiheits-Menü
Schriftgröße
Kontrast
Menü sichtbar
Einstellungen
















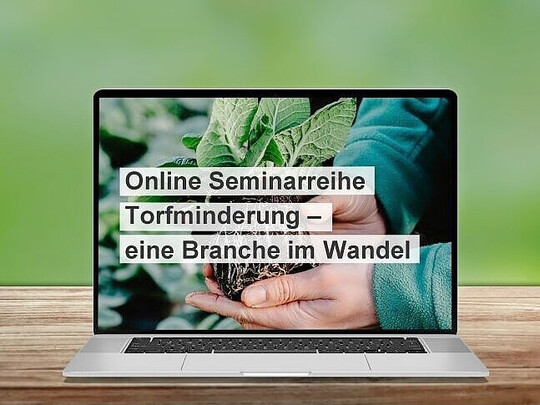

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.
Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.