Miteinander neue Wege finden
- Veröffentlicht am

Vorgestellt wurden Initiativen und Gedanken zur Nachhaltigkeit im Zierpflanzenbau samt vor- und nachgelagerter Bereiche. Ziel war, den Austausch zum Thema anzuregen, es ging um exakte Messungen und Zahlen, um mit diesen weiterzuarbeiten. Die Zukunftsfragen gehen alle etwas an, über Grenzen hinweg. Der Austausch darüber wird uns dauerhaft begleiten.
Voneinander lernen hat für Mariska Dreschler, Direktorin der niederländischen Fachmesse GreenTec, einen hohen Stellenwert. Ihr Anliegen ist es, Plattformen zu bieten, um unterschiedliche Gruppen miteinander ins Gespräch zu bringen und den Zugang zu gesunden Nahrungsmitteln weltweit allen Menschen zu ermöglichen.
„Happy food, healthy flowers" lautete das Motto der diesjährigen GreenTec in Amsterdam, die eine sowohl die Nahrungs- als auch die Blumenproduktion in den Blick nahm. Die Messe entwickelte sich aus kleinen Anfängen zu einer recht großen Veranstaltung mit Besuchern aus über 100 Ländern. Für Mariska Dreschler ein Zeichen, wie auch aus kleinen Initiativen international anerkannte Veranstaltungen werden können.
Ein Prozess des gemeinsamen Lernens
Als laufend sich fortwährend weiter entwickelnden Prozess sieht der Spezialist für nachhaltige Ökonomie und Produktion Dr. David Bek, Coventry University/GB, die Entwicklung zukunftsfähiger Lieferketten auch im Zierpflanzenbau, die zusammen mit Standardisierungen und Zertifizierungen zu sehen seien. Die Auswirkungen der Corona-Pandemie und des Klimawandels regten viele zum Nachdenken an. Es gebe eine deutliche Zunahme bei Käufen von Fairtrade-Produkten. Eine positive Entwicklung, deren Verlauf es abzuwarten gelte.
Für Bek zählt bei diesem Prozess das gemeinsame Lernen. Netzwerke seien dabei hilfreich. Er nannte eine Reihe bereits existierender Nachhaltigkeitsinitiativen von Organisationen für den Gartenbau, darunter
- Floriculture Sustainability Initiative (FSI),
- The Horticultural Trades Association (HTA) – Sustainability Roadmap,
- AIPH – Green Cities Initiative,
- Royal Horticultural Society, Australia – Horticulture Sustainability Framework,
- sowie diverse Standards und Zertifizierungen für mehr Nachhaltigkeit.
Auch die ehrgeizige Floriculture Sustainability Initiative FSI 2025 setze auf Transparenz und gemeinsames Lernen voneinander.
Forschung spielt eine große Rolle, um vergleichbare CO 2 -Fußabdrücke zu ermitteln. Mit Hilfe wissenschaftlich basierter Zahlen sollte der Gartenbau handeln und sich mit Fakten an Diskussionen beteiligen, so der Impuls.
Der Gartenbau sollte sich als Lösung für den Klimawandel positionieren, meint Bek. Die Frage ist, wer die Rechnung zahlt und ob eine ressourcenschonendere Produktion tatsächlich Mehrkosten verursacht. Offen bleibe die Frage, wie sich die Preise für Zubehör und innerhalb der Handelsketten entwickeln.
Die Frage nach Kosten, Mehrwert und Anwenderfreundlichkeit der Zertifizierungen stellte auch Daan de Vries, MPS. Einzelne bereits vorhandene unterschiedliche Verbraucherlabel seien schwer miteinander vergleichbar.
Ziel: ein einheitlicher Fußabdruck
„Der Nachhaltigkeitsprozess ist eine Reise, während der es um gemeinsames Planen, Handeln und Lernen geht", befand Jeroen Oudheusden, der sich als Berater für die Gartenbau-Branche vorstellte. Er leitet die FSI-Initiative seit 2013. Diese ist auf 75 internationale Mitglieder angewachsen. Darunter sind NGOs, Handelspartner, Produzenten und Pflanzenzüchter. Die Lieferkette der FSI-Initiative 2025 berücksichtigt sowohl die Art und Weise von Produktion und Handel als auch den Führungsstil.
Ziel ist auch die Entwicklung neuer Methoden, um den CO 2 -Fußabdruck harmonisiert für alle Gartenbauprodukte zu messen. Es gehe um ein Erarbeiten vergleichbarer Fußabdrücke, der Product Environmental Footprints (PEF). Sie sind letztendlich Grundlage für den Austausch unterschiedlicher Gruppen. Ziel ist ein EU-weit geltender Maßstab für einen Fußabdruck bei Schnitt- und Topfpflanzen entstehen, der als Product Environmental Footprint Category Rules for Cut flowers and Potted Plants (FloriPEFCR) bezeichnet wird.
Das seit 2018 von mehreren Partnern bearbeitete Projekt „HortiFootprint Category Rules" (HFCR) bis zum FloriPEFCR erläuterte Albert Haasnot, Royal FloraHolland. Die Notwendigkeit eines vergleichbaren Fußabdrucks ergab sich auch aus der Nachfrage von Handel und Verbrauchern. Entwickelt wurde ein über mehrere Teststationen laufender, transparenter 21-Stufen-Prozess. Derzeit werden die Stufen 5 bis 7 bearbeitet.
Die Hauptaktivitäten für neue Wege in der Produktion beschränken sich auf Wassermanagement, Plastikverbrauch und Verpackungen, Reduktion chemischer Pflanzenschutz- und Düngemittel sowie den Energieverbrauch. Das ergab eine Umfrage bei Unternehmen aus 25 Ländern, die Dr. Audrey Timm, AIPH, vorstellte.
Wer nur auf den CO 2 -Fußabdruck setzt, verliert andere, ebenfalls wichtige Aspekte aus dem Blick, so Jeroen Oudheusden, FSI. „Greenwashing" gelte es zu vermeiden, um nicht an Glaubwürdigkeit zu verlieren. Hilfreich seien Geschichten rund um nachhaltig produzierte Pflanzen.
Konkrete Aussagen der Fachleute
Aussagen der Teilnehmer während des Austausches auf der Veranstaltung zeigen das Interesse am Thema.
- Nachhaltigkeit ist immer mit dem Auge des Betrachters zu sehen. „Unsere Produzenten sind bereits nachhaltig! Royal Flora Holland als Marktplatz für die Produzenten muss erfolgreich sein, damit diese Produzenten langfristig und damit nachhaltig über uns vermarkten können", unterstrich Maarten Banki.
- In den USA ist der Druck der Verbraucher beim Blick auf die Produktionsweise noch weniger ausgeprägt als in der EU, erklärte Susannah Ball, Ball Horticultural Company/USA. Ihr Unternehmen sei schon längere Zeit am Thema dran. „Der Druck kommt von den Mitarbeitern", so Ball. Es gehe um ähnliche Fragestellungen wie in der EU. So sind Wasserverbrauch, Plastik und Verpackungen in der Diskussion. In der Züchtung legt Ball einen Fokus auf Selektionen, die mit weniger chemischem Pflanzenschutz und Dünger zurecht kommen.
- Für Afrika sprach Richard Fox, Flamingo Group: „Viele dort meinen, ihr wart die Verursacher großer Probleme, warum sollen wir sie lösen?" Dennoch sei es für die Menschen auf diesem Kontinent keine gute Lösung, auf Pflanzen aus Afrika zu verzichten. Fox riet zu guter Kommunikation mit den Verbrauchern und Klarstellung darüber, dass es bei in Afrika produzierten Pflanzen nicht nur um Flugtransporte geht, sondern auch um den geringeren Energieverbrauch für Licht, Heizung und um Chancen für die Arbeitskräfte dort. See-Transporte sieht Fox als Trend der Zukunft.
- „Menschen machen ein Unternehmen wertvoll", erläuterte Richard Fernands, Sommerblumenproduzent in Kenia und Äthiopien das Unternehmensmotto „we grow people, the people grow flowers". Es sei die Aufgabe eines Unternehmers, sich für die Menschen einzusetzen, die das Unternehmen voranbringen.
- Der britische Pflanzenproduzent William Gee, Freddie’s Flowers, riet, gemeinsam zu überlegen und zu planen und neue Maßnahmen gemeinsam umzusetzen.
- Nora Meijerink, Global Sustainability Manager bei Chrysal International, berichtete von einem Fokus des Unternehmens auf Wasser- und Abfallreduktion. Angestrebt werde eine Klimaneutralität bis 2030. Maßnahmen sind unter anderem der Ersatz von heißem durch kaltes Wasser sowie die Nutzung von Wind- und Sonnenenergie.
- „Die Zukunft ist zirkulär", erklärte Sven Hoping, Pöppelmann. Die Welt benötige mehr Plastik, denn aus dem Material lasse sich sehr viel herstellen, es lasse sich recyceln und in vielen Bereichen wiederverwenden. Ausreichend Zirkulärmaterial stehe zur Verfügung.
- „Learning by doing", meinte Ximena Franco aus Kolumbien. Anhand von Pilotprojekten und gesammelten Praxiserfahrungen wird ein Leitfaden zusammen mit der Regierung für eine Kreislaufwirtschaft in der Pflanzenproduktion erarbeitet. „Greenwashing" müsse vermieden werden.
- „Nachhaltigkeit ist die Schlüsselfrage auch bei Substraten", erklärte Moritz Böcking, Klasmann-Deilmann. Die Nachfrage wachse von Jahr zu Jahr. Während der vergangenen fünf Jahre erreichte Klasmann-Deilmann eine Torfreduktion von 15 %. 30 % Torfersatz in den Substratmischungen sollen über die nächsten fünf Jahre realisiert werden. Dies sei nicht nur politisch motiviert, auch ökonomisch würde es sich rechnen.
- Cecilia Luetgebrune, Geschäftsführerin des europäischen Branchenverbands Growing Media Europe, spricht sich dafür aus, Torf und Nachhaltigkeit getrennt zu betrachten. Torf könne genauso nachhaltig sein wie seine Alternativen. Alle Substratzuschlagstoffe wiesen einen CO 2 -Fußabdruck auf. Sie hält einen Umwelt-Fußabdruck, für dessen Bestimmung ein Digitaltool entwickelt wird, für eine gute Idee.
Ein breites Themenfeld
- Nachhaltigkeit hat recht unterschiedliche Facetten. Diese betreffen den Produkt-Input, den Energieeinsatz sowie die Arbeitskräfte und das soziale Umfeld.
- Es ist leicht, Nachhaltigkeit auf die Agenda zu setzen. Schwierig sind die Lösungen.
- Weltweit finden sich viele unterschiedliche Engagements von Ländern, Nachhaltigkeit umzusetzen.
- Es gibt viele ganz verschiedene Nachhaltigkeits-Lösungen.
- Kompliziert ist das Management der unterschiedlichen bereits am Markt erhältlichen Verbraucherlabel (beispielsweise „ich bin von hier" oder das französische Label „Sans Pesticides").
- Viele Messungen müssen her, um aussagekräftige Daten zu erhalten.
- Kosten, Anwenderfreundlichkeit und Mehrwert für Zertifizierungen gilt es zu ermitteln.
- Der Markt fragt zunehmend nach nachhaltig produzierten, zertifizierten Pflanzen.
- Ein Zertifizierungsstandard muss her, um Vergleichbarkeit zu gewährleisten.
- Zertifizierte, nachhaltig produzierte Pflanzen erhöhen das Ansehen der Branche.
- CO 2 -Fußabdrücke sind nicht immer miteinander vergleichbar, da sie auf unterschiedlichen Vorgehensweisen beruhen.
- Wünschenswert und in Arbeit ist ein EU-weit gültiger CO 2 -Fußabdruck für Zierpflanzen.
- Zu einem großen Teil diktiert der Handel mit seinen Marketingaktionen, wo es hingeht.
Nachhaltige Produktion im Netz
- The Horticultural Trades Association (HTA) – Sustainability Roadmap: hta.org.uk/uploads/assets/ac97ad2d-3f22-4a4d-87785cb7b3db0c57/f8b3c4b0-0a27-49fe-8ae86f5ab9494a46/Sustainability-Roadmap-Chartervf.pdf
- AIPH – Green Cities Initiative: aiph.org/green-city/guidelines-2020/
- Australian-Grown Horticulture Sustainability Framework: www.horticulture.com.au/globalassets/hort-innovation/corporate-documents/hort-innovation-australian-grown-horticulture-sustainability-framework.pdf
- FloriPEFCR: https://www.wur.nl/en/show/FloriPEFCR.htm
- aiph.org/floraculture/latest-edition/
- aiph.org/event/sustainability-conference-2021/
Barrierefreiheits-Menü
Schriftgröße
Kontrast
Menü sichtbar
Einstellungen











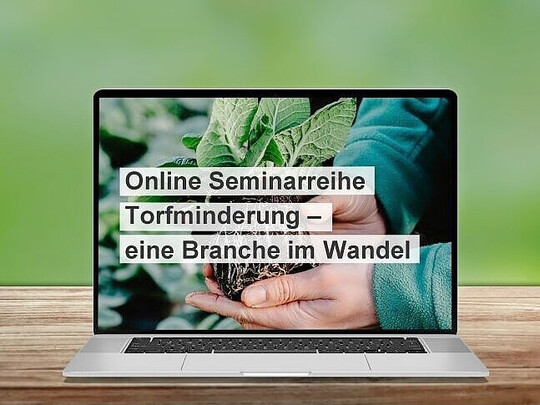

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.
Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.