
Kühlung und Automation
Wenn die Südseite eines Gewächshauses nicht komplett mit Isolierpaneelen eingedeckt und der Rest mit Schirmen versehen ist, brauchen wir über eine Kühlung nicht nachzudenken. Der Wärmeeintrag durch globale und direkte Solarstrahlung ist viel zu groß.
von Rainer Dietrich, Gewächshausbeheizung und Energieberatung GmbH, Schorndorf erschienen am 01.05.2025Eine Beispielrechnung für Gartencenter kann so aussehen: Die Sonneneinstrahlung im Sommer beträgt außen maximal 1.200 W/m², auf der Nordseite 500 W/m². Unterhalb eines Schirms beträgt sie im Sommer noch 100 W/m². Auf der Südseite eines mit Isolierpaneelen eingedeckten Hauses, liegt sie innen bei 50 W/m². Für einen 500 m² großen Cafébereich ergibt sich als Größenordnung eine Kühlleistung von 50 kW.
Kühlung mit reversiblen Wärmepumpen
Reversible Wärmepumpen werden betrieben über Geothermie oder Eisspeicher. Der begrenzende Faktor dabei ist nicht die Wärmepumpe, sondern die Ausbringung der Kälte. Die Ausbringung der Kälte über Bauteile, beispielsweise durch eine Fußbodenkühlung oder über Deckenstrahlplatten, muss nämlich sehr behutsam erfolgen, da sonst der Taupunkt unterschritten wird und Kondensat auftritt. In der Praxis bedeutet dies, dass Kühlflächen nicht kälter als etwa 19 °C sein dürfen. Daraus ergibt sich eine Kühlleistung von etwa 30 W/m². Im Gartencenter werden allerdings 100 W/m² benötigt.
Eine Kühlung durch eine lufttechnische Anlage wie in Büros oder Supermärkten ist sehr teuer. Außerdem bleibt das Problem der Ausbringung von Kälte.
Eine andere und effektivere Methode der Kälteausbringung ist es, den Taupunkt bewusst zu unterschreiten. Es gibt Kühler, die das entstehende Kondensat auffangen und über eine Pumpe und eine Rohrleitung abführen. Die Kühlleistung ist wesentlich höher, die Luftfeuchte im Raum nimmt aber ab.
Adiabate Kühlung
Bei der adiabaten Kühlung wird Wasser unter Hochdruck vernebelt und über Ventilatoren im Raum verteilt. Durch die Verdunstung entsteht Kälte.
Dies kann direkt oder indirekt erfolgen: Entweder wird der „Wasserdampf“ direkt in den Raum abgegeben und die Luftfeuchte im Raum steigt. Im anderen Fall entsteht die Verdunstungskälte auf der Primärseite eines Wärmetauschers und die Luft durchströmt die Sekundärseite, ohne mit dem Wasser in Berührung zu kommen.
Das Gebäudeenergiegesetz (GEG) und die Automation
Der Paragraph 71a des GEG vom Oktober 2023 ging in der öffentlichen Diskussion um den Heizungstausch bisher ziemlich unter, obwohl er weitreichende Konsequenzen hat.
Auszugsweise gilt für Nichtwohngebäude mit einem Energiebedarf von mehr als 290kW: „Ein Nichtwohngebäude mit einer Nennleistung der Heizungsanlage oder der kombinierten Raumheizungs- und Lüftungsanlage von mehr als 290 Kilowatt muss bis zum Ablauf des 31. Dezember 2024 mit einem System für die Gebäudeautomatisierung und -steuerung ... ausgerüstet werden.“
Das bedeutet für Nichtwohngebäude im Bestand im Wesentlichen:
- Es wird eine elektronische Raumtemperaturregelung gefordert, deren Stelleinrichtungen herstellerunabhängig kommunikativ vernetzt sind.
- Die Vorlauftemperaturregelung muss bedarfsgerecht geregelt sein. Eine reine Außentemperaturregelung ist nicht ausreichend. Der Wärmebedarf der einzelnen Räume muss dem Erzeuger rückgemeldet werden. Dieser muss sich dem gemeldeten Bedarf anpassen.
- Es ist eine Person (Firma) zu benennen, die sich um einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess bemüht.
Dabei stellt sich allerdings die Frage, wie das alles kontrolliert werden soll. Im Bestand sollte man wohl erst einmal abwarten, welche Lösungen präsentiert werden.
Anders stellt sich die Lage für neu zu errichtete Nichtwohngebäude dar. Hier erscheint eine Kontrolle wahrscheinlicher und es drohen Regressforderungen.
Zusätzlich zu den oben genannten Forderungen muss:
- Eine Gebäudeautomation mindestens gemäß dem Automatisierungsgrad B (DIN 18599-11) installiert werden.
- Alle Energieverbräuche müssen kontinuierlich gemessen und ausgewertet werden. Die Daten müssen über eine herstellerneutrale Schnittstelle auslesbar sein.
Das Ganze wird dadurch etwas unübersichtlich, weil mehrere Normen und das Gesetz zusammenspielen. Es ist dringend geraten, einen Fachplaner hinzuzuziehen.
Zusammengefasst gilt:
- Wenn eine Anlage über 290 kW Leistung hat, wird mindestens Automatisierungsgrad 3 benötigt. Dies ist mit einem aktuellen Gartenbaucomputer umsetzbar.
- Alle Energieverbräuche sind kontinuierlich zu erfassen und digital herstellerunabhängig zu protokollieren.
- Es ist eine Person zu benennen, welche dies überwacht, analysiert und einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess sicherstellt.
Wichtig in diesem Zusammenhang: Diese Regelungen gelten nicht für Produktionsgartenbaubetriebe.
Das kWp (Kilowatt peak) ist die Einheit, in der die Leistung einer PV-Anlage angegeben wird. 1 kWp werden im Hochsommer von etwa 6 m² Solarpaneele erzeugt. Aus 1 kWp ergibt sich ein Jahresertrag von etwa 1.000 kWh.
Um eine sinnvolle PV-Nutzung zu gewährleisten, sollten alle nach Süden ausgerichteten Dachflächen, die mit Isolierpaneelen eingedeckt sind, mit PV-Paneelen bestückt werden.
Die optimale Neigung für eine PV-Paneele ist 30°. Die ideale Ausrichtung ist nach Süden. Anlagen mit SO- oder SW-Ausrichtung sind noch vertretbar, alles andere nicht. Dabei ist unbedingt auf Verschattung durch andere Gebäudeteile zu achten.
Eine effektive Nutzung von PV setzt eine entsprechende Planung zur Ausrichtung des Gartencenters voraus.
PV-Anlagen lassen sich gut kombinieren mit der Beleuchtung, mit Wärmepumpen (einschließlich Kühlung) sowie betriebseigenen und Kundenfahrzeugen.
Neue Parkplätze müssen seit 2022 ab 35 Stellplätzen mit einer PV-Anlage überdacht werden.
PV-Anlagen sind nicht zulässig für eine geforderte Notstromversorgung. Der Ertrag im Winter entspricht etwa 20 % des Ertrags im Sommer.
Batteriesysteme sind derzeit noch sehr teuer.



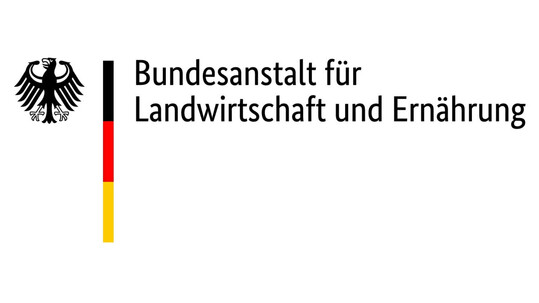





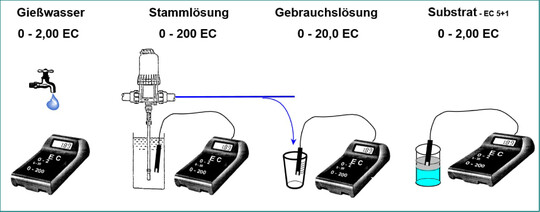


Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.
Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.