
Erfolgreich kultivieren und vermarkten
Die Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen (LWK NRW) lud im November 2024 zum traditionellen Schnittblumentag nach Straelen ein. Mehr als 80 Teilnehmer besuchten die Veranstaltung, um sich über Aktuelles zu Pflanzenschutz, Vermarktung und Ergebnissen aus den Versuchen zu informieren.
von Peter Tiede-Arlt, Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen, Versuchsleiter Zierpflanzen in Straelen erschienen am 16.04.2025
Elisabeth Götte vom Pflanzenschutzdienst der LWK NRW ging zunächst auf Angaben zur Zulassung auf der Pflanzenschutzpackung ein, die im Alltag vermutlich nicht immer mit großer Aufmerksamkeit wahrgenommen werden, bei einer Kontrolle jedoch schnell relevant werden können.
Die Zulassungsnummer steht unterhalb des Logos des Bundesamtes für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL). Sie ist in drei Blöcken aufgebaut:
- Die ersten zwei Ziffern beschreiben die Generation des Pflanzenschutzmittels
- Anschließend folgen vier Ziffern, welche die Pflanzenschutzmittel-ID abbilden – neue Zulassungen können auch Buchstaben-Zahlen-Kombinationen sein
- Zum Schluss stehen zwei Ziffern, welche die Vertriebserweiterung beschreiben
Götte wies darauf hin, dass in unterschiedlichen Generationen eines Pflanzenschutzmittels unterschiedliche Indikationen (Anwendungsbereiche) zugelassen sein können. Dies kann bedeuten, dass ein lang bekanntes Mittel, das regelmäßig im Betrieb angewendet wird, durchaus in einer Zwischengeneration für die im Betrieb erfolgten Applikationen nicht mehr zugelassen ist.
Sollte ein Pflanzenschutzmittel zeitweise im Inland nicht verfügbar sein, besteht die Möglichkeit, es als Parallelimport einzuführen. Hier gilt allerdings, dass Parallelimporte immer nur für einzelne Betrieben nach erfolgter Antragstellung und Genehmigung beim Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL) möglich sind. Der Gartenbaubetrieb kann Pflanzenschutzmittel zum Eigenbedarf einführen, wenn in Deutschland bereits ein identisches Mittel zugelassen ist und eine deutsche Gebrauchsanweisung vorliegt.
Neuerungen bei der Aufzeichnungspflicht
Das Aufzeichnen von Pflanzenschutzmaßnahmen gehört zum Alltag in gartenbaulichen und landwirtschaftlichen Unternehmen. Die Inhalte sind den Betrieben geläufig. Dennoch gab Elisabeth Götte Tipps zur Optimierung der Dokumentationen:
Das angewendete Pflanzenschutzmittel soll mit vollständigem Namen eingetragen sein. Das beugt Verwirrungen bei mehreren möglichen Mitteln mit gleichem „Hauptnamen“ und unterschiedlichen Indikationen vor. Der Anwender ist klar einzutragen und als Person identifizierbar. Einträge wie „Chef“ oder Spitznamen von Mitarbeitern bringen bei Kontrollen Rückfragen mit sich. Alle Aufzeichnungen sind vom Betrieb drei Jahre lang aufzubewahren.
Ab 2026 wird die Aufzeichnung von Pflanzenschutzmaßnahmen novelliert. Die Durchführungsverordnung (EU) 2023/564 wurde im März 2023 verabschiedet und tritt am 1. Januar 2026 in Kraft. Die Eintragungen werden dann digital geführt und erfolgen maximal 30 Tage nach dem Anwendungstermin. Bei der Aussaat von gebeiztem Saatgut gilt der Saattermin als Pflanzenschutztermin. Auf Nachfrage der zuständigen Behörden sind die Daten dann zur Verfügung zu stellen. In Deutschland ist ein webbasiertes Eingabemodul geplant, das man derzeit noch konzipiert. Details zu den Aufzeichnungen ab 2026 erfahren Sie zu einem späteren Zeitpunkt.
Nach Ablauf der Zulassung eines Pflanzenschutzmittels oder für Produkte, deren Wirkstoffe nicht mehr registriert sind, gilt die allgemeine Entsorgungspflicht für den Besitzer über einen fachgerechten Entsorgungsbetrieb.
Auch zum Bienenschutz gab Elisabeth Götte wichtige Informationen weiter. So kann zum Beispiel ein Pflanzenschutzmittel mit der Einstufung B4 (nicht bienengefährlich) durch Mischung mit einem anderen Pflanzenschutzmittel zu einer B1-Tankmischung (bienengefährlich) werden.
Wichtig dabei ist die Anwendungsbestimmung NB6612. Diese besagt, dass ein Pflanzenschutzmittel, zum Beispiel Mospilan SG oder Sivanto Prime (B4), nicht mit einem Fungizid aus der Gruppe der Ergosterol-Biosynthese-Hemmer (Wirkstoffgruppen G1, G2, G3) gemischt und über blühende Pflanzen appliziert werden darf, da durch die Mischung eine Bienengefährlichkeit nach B1 hervorgerufen wird.
Andere Pflanzenschutzmittel können in Kombination mit den entsprechenden Fungiziden eine B2-Einstufung erhalten. Daher ist beim Mischen verschiedener Pflanzenschutzmittel neben der Verträglichkeit immer auch die Wirkung auf die Bienengefährlichkeit zu beachten. Der Bienenschutz greift ergänzend dazu seit 2019 auch in Gewächshäusern, da sie nicht mehr generell als bienensichere umschlossene Räume bewertet werden. Daher ist dem Bienenschutz bei der Anwendung von Pflanzenschutzmitteln in Gewächshäusern und bei Tankmischungen von Insektiziden und Fungiziden noch einmal eine besondere Bedeutung zuzumessen.
Tipps und Tricks zum Nützlingseinsatz
Marion Ruisinger, Spezialberaterin für den biologischen Pflanzenschutz im Zierpflanzenbau an der LWK NRW, stellte heraus, wie wichtig die Lausbestimmung bei der Blattlausbekämpfung ist. Nützlinge gegen Blattlausarten sind teilweise sehr spezifisch und selektiv, sodass ein allgemeiner Einsatz in der Regel nur „Glückstreffer“ zum Erfolg bringt.
Der Einsatz von Räubern oder Parasitoiden ist abhängig von der Schaderregerdichte: Räuber benötigen eine hohe Dichte an Blattläusen, während Parasitoide auch bei geringerem Schädlingsbefall effektiv sein können.
Beachtung sollten bei der Auswahl der Nützlinge neben der Blattlausart auch deren optimale Temperaturfenster finden. Gerade bei Temperaturen unter 15 °C ist die Auswahl geeigneter Schlupfwespen eingeschränkt. Die Schlupfrate reduziert sich bei niedrigen Temperaturen deutlich auf 60–85 %, wie Versuche von Ruisinger zeigen. Auch stark schwankende Temperaturen im Gewächshaus wirken sich auf die Nützlingseffizienz aus. So ist die Absenkung von Heiztemperaturen aus energetischer Perspektive sinnvoll, beeinflusst jedoch die Schlupf- und Parasitierungsrate der Tiere. Daher empfiehlt Ruisinger, bei niedriger Temperaturführung die angepasste Schlupfwespenart auszusetzen, die Einsatzintervalle zu verkürzen und die Einsatzmenge zu erhöhen. Positiv wirkt sich auch aus, wenn man die Schlupfwespen an einem wärmeren Ort vorschlüpfen lässt oder die Temperatur im Gewächshaus nach dem Einsatz kurzzeitig erhöht.
Marion Ruisinger ging außerdem auf die biologische Thripsbekämpfung ein. Da die meisten Raubmilben Thripse im L1-Stadium fressen und dieses Stadium am Beispiel von Frankliniella occidentalis bei 15 °C 4,9 Tage, bei 30 °C jedoch nur noch 1,1 Tage dauert, ergibt sich ein kurzes Zeitfenster für den optimalen Einsatz.
Auch bei den Raubmilben gibt es mittlerweile eine Auswahl verschiedener Arten zum Einsatz in verschiedenen Temperaturprofilen. Die Ausbringung der Raubmilben erfolgt in vielen Betrieben im Laufe der Jahre maschinell, teils mit selbst umgebauten Geräten. Das maschinelle Ausbringen erhöht die Gleichmäßigkeit der Verteilung, beschleunigt den Arbeitsprozess und ist auf größeren Flächen mit geringem Wegeanteil leichter möglich.
Für die Ausbringung ist es notwendig, das Trägermaterial zu strecken, um genügend Material für die Gesamtfläche zur Verfügung zu haben. Meistens wird Vermiculit dafür genutzt. Zur Applikation der Raubmilben wird empfohlen, die Tiere bald nach der Lieferung auszubringen. Bei der Verwendung von Vermiculit als Streckungsmaterial ist es sinnvoll, Material mit einer Körnung von 3–5 mm zu verwenden und es mit 2 Liter Wasser je 100 Liter Material anzufeuchten. Zur Vermeidung der Austrocknung des Materials ist eine umgehende Applikation ratsam. Die Lagerung des Materials sollte in einem Kunststoffgefäß erfolgen.
Die übergreifenden Tipps bei der Bestellung und Anwendung von Nützlingen fasste Ruisinger zusammen:
- Mit Expresslieferung bestellen
- Nützlinge schnell nach Erhalt im Bestand ausbringen. Bei späterer Applikation Lieferung kühl lagern.
- Nützlinge nicht in der Mittagshitze ausbringen
- Klimaansprüche der Tiere beachten. Gegebenenfalls das Klima im Gewächshaus anpassen.
- Hinweise des Nützlingsproduzenten auf den Beipackzetteln beachten
- Bei der Lieferung flugfähiger Nützlinge Packung erst am Einsatzort öffnen
- Stichproben einer Lieferung geben Aufschluss über die Menge der Nützlinge und deren Qualität

Wie entwickelt sich der Markt für Schnittblumen?
Hans-Peter Riskes, Teammanager Sortimentsmanagement Schnitt/Versteigerer Schnittblumen bei der Veiling Rhein-Maas, warf mit langjähriger Erfahrung einen Blick auf die Marktentwicklungen aus Sicht der Versteigerung in Herongen. Er betrachtete die zurückliegende Saison (Oktober 2023 bis Oktober 2024): Der Uhrvorverkauf legte beim Umsatz um 3,8 % zu, eine positive Entwicklung.
Der Fernkaufanteil des Umsatzes liegt im Berichtszeitraum mit 40,5 % hoch. Für die Abwicklung der Ware über Fernkauf sind gute Produktfotos wichtig, so Riskes.
Im Gesamtumsatz beträgt das Verhältnis von Schnittblumen zu Topfpflanzen 39:61. Seit 2021 ist die Anlieferung von Schnittblumen um etwa 30 Millionen Stiele gesunken. Die Ursachen dafür sind vielfältig und von den Kulturen abhängig. Während die Anlieferung bei wichtigen Artikeln wie Rosen bis Oktober um 1 % geringer war als im Vorjahr, wurden 2024 26 % weniger Tulpen angeliefert. Das steht in engem Zusammenhang mit der schwierigen Zwiebelproduktion durch die niederschlagsreichen Sommer und den damit verbundenen Ausfällen bei den Zwiebellieferanten. Dadurch sind die Zwiebelpreise erheblich angestiegen, die Sorten waren unsicher verfügbar, sodass die Tulpen treibenden Betriebe ihre Produktion teilweise reduziert oder ganz aufgegeben haben.
Riskes sieht große Herausforderungen für die Betriebe. Neben der Energie, die bei Schnittblumen einen großen Anteil an den Produktionskosten hat, war die Witterung in den letzten zwei Jahren nicht einfach für die Freilandproduzenten. Zudem klagen die Betriebe über einen Mangel an Arbeitskräften und über viel Bürokratie.
Aus Sicht der Veiling macht er Hoffnung: Die Preise je Stiel sind im Durchschnitt um fast 19 % gestiegen und die Nachfrage war mit Ausnahme des Sommerlochs im August 2024 stabil. Allerdings erfährt Riskes von seinen Großkunden von Veränderungen im Kaufverhalten der Endverbraucher, die kleinere Gebinde kaufen und zudem seltener einkaufen.
Riskes ermutigt, sich mit Produkten auseinanderzusetzen, die von der Veiling noch gesucht werden:
- Freilandchrysanthemen für den Spätsommer bis Herbst
- Paeonia außerhalb der Hauptsaison
- Callistephus in Farben oder gemischt
- neue Sorten von Hypericum und Sedum
- Schnittgehölze, zum Beispiel Flieder in verschiedenen Farben
- Sommerblumen wie Gladiolen und Dahlien
- Tulpen
- Freilandschnittblumen allgemein
Die Veiling unterstützt die Produzenten bei der Produktpräsentation im Foyer in Herongen. Digitale Kurzfilme lassen sich auf dem Uhrdisplay zeigen. Bilder können in Newslettern versendet werden. Das Sortimentsmanagement fördert die Produzenten rundum und steht den Gärtnern zur Verfügung.











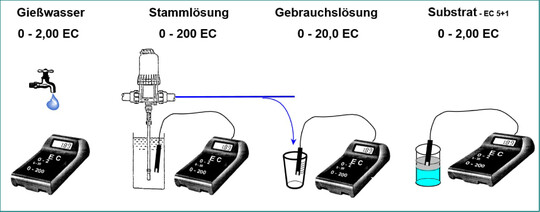




Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.
Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.