
Wie Ressourcen künftig gesichert werden
Klimawandel, Digitalisierung und demografischer Wandel stellen Anforderungen an die Genbanken von morgen. Rund 80 Teilnehmende von Genbanken, Botanischen Gärten, Züchtung, Politik und Praxis erarbeiteten diese Woche im Bundesministerium für Landwirtschaft, Ernährung und Heimat (BMLEH) in Bonn Lösungen dafür, wie genetische Ressourcen künftig bewahrt und zu Forschungszwecken zur Verfügung gestellt werden müssen.
von BLE erschienen am 07.11.2025„Erhaltung ist ein Marathon und kein Sprint“
Die sechs großen deutschen Genbanken erhalten über 180.000 Pflanzenmuster von über 3.000 Arten; eine große Vielfalt, die Ausgangspunkt für Forschung und Innovation ist und einen Beitrag zur globalen Ernährungssicherung in Zeiten des Klimawandels leistet. „Doch diese Erhaltung ist ein Marathon und kein Sprint. Sie ist eine dauerhafte, komplexe und zunehmend herausfordernde Aufgabe, die beständige Weiterentwicklung und Anpassung erfordert“, so Olaf Schäfer, Leiter der Unterabteilung „Klimaschutz, Biodiversität, Fischerei, Bioökonomie“ im BMLEH.
Das Ministerium hatte zu der Veranstaltung gemeinsam mit dem Informations- und Koordinationszentrum Biologische Vielfalt (IBV) eingeladen. Dabei gab es zahlreiche Ideen, wie die Politik die Genbankarbeit unterstützen könne. Prof. Dr. Henryk Flachowsky vom Julius Kühn-Institut in Dresden-Pillnitz forderte: „Genbanken sollten als kritische Infrastruktur betrachtet und finanziell entsprechend abgesichert werden.“
Wie sich Genbanken immer wieder anpassen und neu erfinden können, erläuterte Prof. Dr. Nils Stein vom Leibniz Institut für Pflanzengenetik und Kulturpflanzenforschung. Er stellte seine Vision für die Bundeszentrale Ex-situ-Genbank in Gatersleben vor und erläuterte wie die Transformation von einer klassischen Genbank zu einem biologisch-digitalen Ressourcenzentrum gelingen kann. So würde eine genomweite Sequenzierung einer Kulturart, beispielsweise Gerste, über mehrere Genbanken hinweg aussagekräftigere Daten hervorbringen.
Nutzergruppen wünschen einfachen Zugang zu guten Daten
Dass dies genau den Bedarf der Züchterinnen und Züchter traf, machte Prof. Dr. Friedrich Longin von der Landeszuchtanstalt der Universität Hohenheim deutlich. „Wir brauchen einen einfachen Zugriff auf aktuelle Daten“, beschrieb er seine Erwartungen an die Genbanken. Eine schnelle und systematische Routinedatenerfassung sowie -verfügbarkeit sei essenziell.
Zudem brauche es abgestimmte Programme, mehr Austausch und ein langfristiges Pre-Breeding-Programm für die Heranführung an den Markt. „Und wenn dann die Wertschöpfungskette mit aufspringt, kann eine Sorte erfolgreich werden“, so Longin. Bei Dinkel sei das gelungen: „Wir haben aktuell 14 Sorten im Anbau.“
Internationale Zusammenarbeit am Beispiel Gelbrost
Das in der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE) angesiedelte IBV arbeitet als Partner der Genbanken unter anderem für die internationale Vernetzung. Dass dies fruchtet und welche Bedeutung das Material in Genbanken für die Welternährung besitzt, machte Dr. Katharina Jung von der Universität Zürich deutlich. Sie erläuterte, dass 88 Prozent der globalen Weizenproduktion von Gelb-rostinfektionen betroffen seien. In asiatischen Landsorten, die sie von der japanischen Genbank in Kyoto beziehen konnte, fand sie vielversprechende Gene, die eine Resistenz gegen Gelbrost liefern könnten.
Die Ergebnisse der Dialogveranstaltung von BMLEH und IBV dienen im nächsten Jahr als Baustein für politische Weichenstellungen, um die Nationale Strategie zu genetischen Ressourcen für Ernährung, Landwirtschaft, Forst und Fischerei mit Leben zu füllen und umzusetzen.





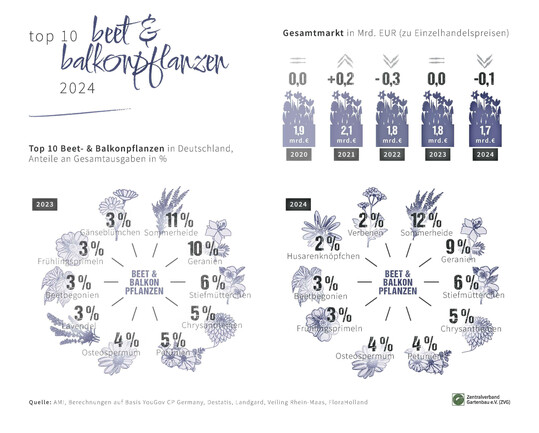







Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.
Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.