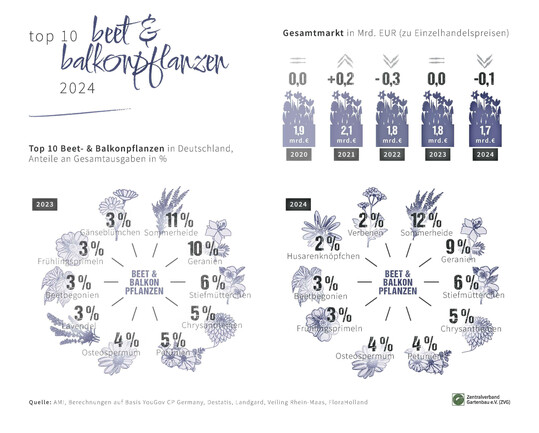
Die Rahmenbedingungen stehen auf Erfolg
Am 24. und 25. Juni 2025 findet in Berlin der INUGA-Kongress 2025 zu Gegenwart und Zukunft des Urbanen Gartenbaus statt. Zu diesem Anlass widmet sich der Beitrag dem Stand der Dinge bei diesem noch immer recht neuen Feld.
von Prof. Dr. habil. Hartmut Balder, Institut für Stadtgrün und Dr. Marianne Altmann, CO CONCEPT, beide aus dem INUGA-Team (www.inuga.de) erschienen am 10.06.2025Die langjährige Forschung in Land- und Forstwirtschaft sowie in den gartenbaulichen Disziplinen hat mit vielen Innovationen die Erträge qualitativ und quantitativ verbessert und sichert heute den Betrieben eine relativ gesicherte Arbeitsgrundlage. Hingegen ist der Umgang mit der Kulturpflanze in urbanen Räumen eher stiefkindlich entwickelt, obwohl hier große Investitionen auf privaten und öffentlichen Flächen getätigt werden. Mit der Einführung der neuen Disziplin „Urbaner Gartenbau“ durch das Bundeslandwirtschaftsministerium 2003 auf dem Internationalen Kongress „Plant Health in Urban Horticulture“ in Berlin für Europa werden die spezielle Produktion von Pflanzen für die urbane Verwendung, angepasste Vegetationstechniken und Pflegesysteme fokussiert. Wissenschaft und freie Wirtschaft sind aufgefordert, innovative Konzepte zu entwickeln und zu erproben.
Die Weiterentwicklung der Städte in Bezug auf Anpassung unter anderem an den Klimawandel, die Mobilität, den Biodiversitätsverlust und veränderte Lebensformen löst immer mehr Aktivitäten zur Stärkung der blau-grünen-Infrastruktur aus. Nach wie vor unterstützt der Bund durch das Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen (BMWSB) die Kommunen und Städte finanziell durch die sogenannte Städtebauförderung, um
- Innenstädte und Ortszentren in ihrer städtebaulichen Funktion, auch unter Berücksichtigung des Denkmalschutzes zu stärken,
- die Herstellung nachhaltiger städtebaulicher Strukturen in von erheblichen städtebaulichen Funktionsverlusten betroffenen Gebieten, wie Wohnungsleerstand oder Brachflächen in Innenstädten, insbesondere von Industrie-, Konversions- und Bahnflächen zu ermöglichen und
- städtebauliche Maßnahmen zur Behebung sozialer Missstände zu unterstützen.
Die Städte sollen klimaresilienter werden
Die Förderung des Stadtgrüns in allen Formen ist Bestandteil des bundespolitischen Ansatzes und wird im Zweiten Statusbericht zum Städtebauförderungsprogramm „Drei Jahre Zukunft Stadtgrün“ (BBSR, 2021) dargelegt. Zahlreiche Projekte der Nationalen Stadtentwicklungspolitik sollen das Bewusstsein für den Wert von Stadt und Urbanität stärken. Sie zeichnen das Bild einer innovativen und lebendigen Stadtentwicklungslandschaft; der urbane Gartenbau spiegelt sich hier in seiner ganzen Breite wider.
Mit der Stärkung des natürlichen Klimaschutzes verbunden, sind aktuelle Förderungen des Bundesministeriums für Umwelt, Klimaschutz, Naturschutz und nukleare Sicherheit (BMUKN), die auf Kommunen und Städte abzielen und im Speziellen die Pflanzung von Bäumen und die Einführung naturnaher Grünflächenpflege betreffen.
Das Klimaanpassungsgesetz ist zwischenzeitlich in Kraft getreten. Mit dem Gesetz wird erstmals ein strategischer Rahmen für eine vorsorgende Klimaanpassung auf allen Verwaltungsebenen in Deutschland geschaffen. Mit diesem Gesetz werden die Länder beauftragt, für systematische und flächendeckende Klimaanpassungsstrategien in den Ländern und für Klimaanpassungskonzepte für die Gebiete der Gemeinden und Kreise zu sorgen. Die Bundesregierung verpflichtet sich damit dazu, in Zukunft eine vorsorgende Klimaanpassungsstrategie mit messbaren Zielen zu verfolgen. Die soeben beschlossene deutsche Anpassungsstrategie an den Klimawandel 2024 (DAS) fordert in Erfüllung des Bundesklimaanpassungsgesetzes (2023) die gesicherte Aktivierung von Stadtgrün, um Hitzebelastungen zu reduzieren (BMUKN, 2024). Aktuell werden in den Bundesländern zur Unterstützung vom Bundesamt für Naturschutz (BfN) Klimabüros zur Beratung eingerichtet.
Der Bund Deutscher Landschaftsarchitektinnen und -architekten möchte auf Grundlage des Entwurfs zur Novellierung des Baugesetzbuchs Empfehlungen für einen klimaresilienten Städtebau als seinen Beitrag zum Gelingen der Herausforderungen des Klimawandels vorlegen und letztlich erreichen, dass die Stadtbegrünung gesetzlich verankert werden soll. Am 4. September 2024 hat das Bundeskabinett dem Entwurf zugestimmt.
Mit dem gleichen Ziel hat die EU am 12. Juli 2023 die „Nature Restoration Law. COM (2022) 304“ beschlossen, die auf die Wiederherstellung der natürlichen Ökosysteme abzielt. Für städtische Ökosysteme (Artikel 6) folgt daraus, dass die europäischen Mitgliedstaaten sicherstellen müssen, dass bis 2030 in (Klein-)Städten und Vororten kein Nettoverlust an urbanen Grünflächen und Baumüberschirmung gegenüber 2021 zu verzeichnen ist. Weiterhin soll die nationale Gesamtfläche urbaner Grünflächen bis 2040 um mindestens 3 % und bis 2050 um mindestens 5 % erhöht werden. Bezüglich der urbanen Baumüberschirmung gilt, dass sich diese bis 2050 auf mindestens 10 % in Kleinstädten und Vororten beläuft. Insgesamt soll vor allem auch ein Nettogewinn an städtischen Grünflächen erreicht werden, der durch die Integration von urbanem Grün in bestehende und neue Gebäude sowie in Infrastrukturentwicklungen forciert werden soll.

Neue Chancen für den urbanen Gartenbau
Zusammenfassend bedeutet dies, dass künftig mehr auf Qualität als auf Quantität zu setzen ist. Pflanzen in urbanen Räumen müssen funktionaler verwendet werden – nur bei auskömmlichen Wuchsbedingungen lassen sich vitale und gesunde Entwicklungen der Pflanzen erzielen. Die Verordnung wurde am 24. Juni 2024 final von der EU unterzeichnet. Alle europäischen Länder müssen jetzt Vorschläge erarbeiten, wie sie diese in ihrem Land umsetzen wollen.
In all diesen Bestrebungen spiegelt sich der politische Wille wider, die menschlichen Lebensräume zu stärken, eine nachhaltige und ressourcenschonende Stadtentwicklung voranzubringen und die natürlichen Prozesse zu stabilisieren. Diese Ziele werden gefordert, aber kaum konkret mit fachlichen Inhalten untermauert. Urbane Pflanztechnologien sind genauso wenig erforscht wie auch abgesicherte Pflanzenlisten zur differenzierten Verwendung in den Grünkonzepten. Es mangelt nach wie vor an erprobten Pflegekonzepten sowie an der qualitativen Ausstattung der Verantwortlichen.
Es ist davon auszugehen, dass mit dem Transformationsprozess der Städte der Bedarf an Pflanzen, Sträuchern und Bäumen sowie das Angebot von vor Ort produziertem Obst, Gemüse und anderen pflanzenbasierten Nahrungsmitteln steigen wird. Die Gartenbauproduktion sollte dementsprechend angepasst werden. Der urbane Gartenbau bietet zukünftig neue Absatzpotenziale.
Genau hier setzt der INUGA-Kongress 2025 (Urbaner Gartenbau – Gegenwart und Zukunft) an, um erste Projektergebnisse aus der Innovationsförderung des Bundeslandwirtschaftsministeriums zu präsentieren und den akuten Forschungsbedarf aufzuzeigen.













Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.
Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.