Verhaltener Optimismus
- Veröffentlicht am

Andreas Kröger nannte die drei Produktionsfaktoren Wasser, Torf und Energie. Es sei Beratung nötig, um die Betriebe vor Wassermangel zu schützen. Bereits heute gibt es Konflikte in Bezug auf die Wasserverfügbarkeit. Sinnvoll seien eine Bund-Länder-Strategie für den Gartenbau und Kooperationen für die Wasserinfrastruktur.
Die Diskussion um die Torfreduktion verschärfe sich vor dem Hintergrund steigender Preise für Torfalternativen. Holzersatzstoffe sind teuer und knapp. Daher gelte es, die Torfproduktion in Norddeutschland zu sichern, die Torfminderungsstrategie praktikabel auszugestalten und die europäische Gleichbehandlung zu wahren. „Ohne deutschen Schwarztorf ist es schwierig in der Gemüsejungpflanzenanzucht", verdeutlichte er.
„Laut einer ZVG-Umfrage sehen die Hälfte der Unternehmen ihre Existenz zumindest teilweise gefährdet", ging Kröger auf das Hauptthema Energie ein, für das er schnelle Lösungen vor dem Winter forderte. Die Vervielfachung der Energiekosten betreffe auch den Endverkauf, auch dort wurden Gasverträge gekündigt. Die Kurzarbeiterregelung müsse dort greifen.
Der nun beschleunigte Strukturwandel gehe zu Lasten der Deutschen Wirtschaft. Mittelständische Betriebe und damit viel Wissen gehen verloren. Es gibt kein „Weiter so".
Europäische Konkurrenz steht bereit
Trockenheit, der damit verbundene Gießaufwand und schließlich der Arbeitskräftemangel führen zu Umsatzverlusten im Friedhofsgartenbau. Das Wirtschaften mit Langzeitverträgen ist bei heutiger Kosten- und Zinsentwicklung kaum mehr möglich, so Kröger.
Der Gemüsebau schaut zurück auf ein Jahr der Extreme. Die europäische Konkurrenz stehe bereit, die deutschen Regale zu füllen. Der Zierpflanzenbau leidet unter der Unsicherheit, ob die Menschen im kommenden Jahr überhaupt noch Blumen kaufen werden.
Das große Produktionsgebiet Gönnebek in Schleswig-Holstein leidet unter Stillstand bei notwendigen Modernisierungsmaßnahmen. In der in den 60er-Jahren mit öffentlicher Starthilfe als Sondergebiet Gartenbau gegründeten Siedlung befinden sich derzeit noch zehn Gartenbaubetriebe mit unterschiedlichen Zukunftsplänen. Man sei hier mitten in einer Findungsphase, auch vom Lande gebe es bereits Visionen. Sowohl ein Verkauf der Fläche einzelner Betriebe wie auch eine bauliche Investition sei momentan kaum möglich unter den ungewissen Bedingungen.
Regionalität bleibt wichtig
Die Marke „im Norden gewachsen" sorgt seit zwei Jahren für Aufklärung zur Pflanzenherkunft und weckt auch das Interesse am Beruf Gärtner. In Bremen existiere nach kurzfristiger Schließung eines Produktionsbetriebs bereits keine ausreichende Beschaffung mehr für regional vor Ort produzierte Pflanzen, was vor allem der Friedhofsgartenbau spüre.
Für viele Gärtner war 2022 kein schlechtes Jahr, auch wenn es durch Dürre geprägt war. Es gelte aufzupassen, dass mit dem Ende vieler Betriebe das botanische Wissen nicht verloren geht.
Neues Ministerium in Schleswig-Holstein
Das neue Ministerium für Landwirtschaft, ländliche Räume, Europa und Verbraucherschutz in Schleswig-Holstein befindet sich noch im Aufbau, erklärte Jürgen Blucha aus der Abteilung nachhaltige Landentwicklung, der in Vertretung von Landwirtschaftsminister Werner Schwarz das Ministerium vorstellte. Die vier Fachabteilungen weisen unterschiedliche Kompetenzen für den Gartenbau auf. So hat die Abteilung Landwirtschaft auch für den Gartenbau mit den Zuständigkeiten unter anderem für Düngemittelverordnung, Pflanzenschutz sowie Wasserschutz- und Verfügbarkeit Bedeutung. „Es dauert noch eine Weile, bis wir in dem neuen Ministerium gut zusammenarbeiten und schlagkräftig sind", bat er um Geduld.
Das Ministerium will die Produktion in Norddeutschland unterstützen. „Dafür müssen wir den Fachkräftemangel im Blick haben", so Blucha. Die regionale Vermarktung soll besser aufgestellt werden. Die seit 2019 existierende Absatzförderung „im Norden gewachsen", in der sich 17 Produktions- und Einzelhandelsbetriebe zusammengeschlossen haben, sei ausbaufähig und soll weiter unterstützt werden.
Auszubildende gesucht
Neben der Teilnahme an zahlreichen Jobmessen, Besuchen von Stadtteilschulen in Hamburg mit unterschiedlichen Reaktionen und Multiplikatoren zählen auch Betriebsbesuche zu den Aufgaben von Ausbildungsakquisiteurinnen. Die seit April 2022 in Hamburg für die dortige Landwirtschaftskammer (LWK) tätige Hanna Winter ist bemüht, Auszubildende, Praktikums- und Ausbildungsplätze zu finden und zu vermitteln. Dabei spiele die Online-Präsenz eine große Rolle. Viel Zeit investierte sie in den Aufbau eines Netzwerks.
Die Ausbildungsakquisiteurin Celina Teuner betreibt die Nachwuchswerbung im Auftrag der LKW in Niedersachsen. Sie ging auf die Online-Nachwuchswerbung beispielsweise auf Instagram ein. Auf der Seite www.talente-gesucht.de stellen sich Ausbildungsbetriebe vor.
Mitarbeiter binden mit Zusatzleistungen
„Gute Mitarbeiter an den Betrieb zu binden ist günstiger, als neue zu gewinnen", meinte Dominic Döring, R+V Allgemeine Versicherung. Die durchschnittlichen Kosten für die Suche nach und die Einarbeitung einer neuen Fachkraft schlagen im Mittel mit 10.500 € zu Buche. Arbeitgeber mit attraktiver Lohngestaltung zeichnen sich positiv aus. Punkten lässt sich beispielsweise mit einer über die gesetzlichen Vorgaben hinausgehenden betrieblichen Altersversorgung. Angestellte und Auszubildende haben das Recht auf Gehaltsumwandlung. Ein Arbeitgeberzuschuss ist als Betriebsausgabe abzugsfähig, erhöht die Betriebsrente der Mitarbeiter und wirkt sich so positiv auf das Betriebsimage und die Mitarbeiterbindung aus. „Kommunizieren Sie so etwas offensiv", riet Döring.
Betriebliche Krankenversicherungen haben den Vorteil, dass dem Arbeitnehmer keine Gesundheitsfragen gestellt werden. Sie fallen ebenfalls unter die Betriebsausgaben. Auch Angehörige lassen sich mitversichern. Man könne viel machen bei der Lohngestaltung, Döring verwies auf weitere betriebliche Möglichkeiten wie Unfallversicherungen oder Lebensarbeitszeitkonten.
Christian Senft, Gartenbau-Versicherung, erklärte die Versicherung gegen Cyberkriminalität Hortisecur Cyber. Immerhin wurde bereits jedes vierte Unternehmen in Deutschland schon einmal Opfer von Cyberkriminalität. Verschafft sich ein Hacker Zugriff auf die IT-Systeme einer Produktionsgärtnerei, verschlüsselt wichtige Kundendaten und fordert eine hohe Geldsumme für die Entschlüsselung, übernimmt die Gartenbau-Versicherung die Kosten für die Wiederherstellung der Systeme. Die größten Einfallstore erfolgreicher Cyberangriffe sind E-Mails.
Neues Nachweisgesetz
„Bei Neueinstellungen muss der Arbeitgeber sicherstellen, dass der Arbeitnehmer genau weiß, was von ihm erwartet wird. Das muss in Schriftform vor Arbeitsbeginn auf Papier mit Tinte unterschrieben sein", erklärte Sarah Gnau, Verbandsreferentin, Syndikus-Rechtsanwältin WVG Nord, das seit 1995 existierende, jetzt auf EU-Richtlinien basierend nachgebesserte Nachweisgesetz, gültig ab 1. August 2022. Das gilt auch für Saison-Arbeitskräfte und Auszubildende. Sie empfahl, die unterschriebene Papierform für den Fall einer Prüfung vorzuhalten. Bei einer Arbeitsbefristung muss das Enddatum genannt sein. Ruhepausen müssen grundsätzlich angegeben werden, es bleibe jedoch abzuwarten, wie sich die Rechtslage entwickeln wird.
Neben Fortbildungsanspruch und Kündigungsfristen muss auch der Kündigungsprozess genannt sein. Bei Altersvorsorgeverträgen müssen Name und Anschrift des Versorgungsträgers benannt sein. Altverträge müssen nicht neu gestaltet werden. Fragt jedoch der Arbeitnehmer nach, muss der Arbeitgeber innerhalb von sieben Tagen dem Arbeitnehmer die wesentlichen Arbeitsbedingungen schriftlich nachweisen. Ansonsten können negativ gestimmte Arbeitnehmer den Arbeitgeber verklagen. Daher riet Gnau zur Vorsorge, um auf Anfrage von Arbeitnehmern umgehend einen „Beipackzettel" zum Altarbeitsvertrag mit den notwendigen Informationen geben zu können. „Gehen Sie davon aus, dass die Arbeitnehmer davon aus der Presse erfahren, also seien Sie vorbereitet", lautet ihr Praxistipp. Bezüglich des neuen Arbeitszeitgesetz, nachdem Arbeitgeber verpflichtet sind die Arbeitszeiten zu erfassen, riet sie erst einmal zum Abwarten. Momentan gebe es noch keine genaue Vorschrift für die Form der Arbeitszeiterfassung, die aber mit Sicherheit kommen wird.
Energieversorgung sichern – ohne Daten geht es nicht
Die Energiepreise steigen und sind eine ernste Gefahr für den Fortbestand vieler Gartenbauunternehmen. „Es gibt kaum handfeste Daten über die Energieversorgung im deutschen Gartenbau", beklagte Gabriele Harring, Zentralverband Gartenbau (ZVG). Die Politik fragt nach Einsparpotenzialen, die auch im Gartenbau erreicht werden müssen. Daher durchgeführte aktuelle ZVG-Umfragen zur Energiesituation mit einer hohen Rückmeldequote decken über 50 % des Zierpflanzenbaus ab und zeigen allein durch die hohe Meldequote die Bedeutung des Themas. Viele Betriebe planen derzeit Anpassungen wie Reduzierung der Anbaufläche, Anpassung der Klimaregelstrategie oder Umstellung auf erneuerbare Energieträger.
Produktpreise an Kosten anpassen
Herausforderungen in den nächsten Monaten sehen die Betriebe mehrheitlich in explodierenden Betriebsmittelkosten, steigenden Lohnkosten und der allgemeinen Planungsunsicherheit wegen einer drohenden Gasmangellage. Auch Absatzprobleme wurden als Herausforderung genannt.
Immerhin sehen über die Hälfte der antwortenden Betriebe wenigstens zum Teil die Möglichkeit, die Produktpreise an die höheren Kosten anzupassen. „Jede Branche kann gut begründen, warum genau sie nicht eingeschränkt werden darf", zitierte Harring Klaus Müller von der Bundesnetzagentur. Die Bundesregierung stellte laut Antwort einer kleinen Anfrage eine geringe Betroffenheit des Gartenbaus fest, da Produktionsausfall Kollegen in Europa kompensieren können.
Drei Förderbausteine
Das Energiekostendämpfungsgesetz richtet sich nur an energieintensive Betriebe laut KUEBLL-Liste (für staatliche Klima-, Umweltschutz- und Energiebeihilfen) und wird durch die Gas- und Strompreisbremse abgelöst werden, berichtete Harring. Es sei unglaublich aufwendig, den Ausgleich überhaupt zu bekommen und lohne sich nur für sehr große Zierpflanzenbaubetriebe, maximal 50 in Deutschland, schätzte Harring. Sie betonte in diesem Zusammenhang nochmals die Wichtigkeit von Umfragen, um der Politik aussagekräftige Daten zu liefern.
Die Anpassungsbeihilfe für die Landwirtschaft setzt die Versorgungssicherheit mit Lebensmitteln in den Fokus des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL), wobei Ergebnisse einer Thünen-Studie ignoriert werden und nicht für den Zierpflanzenbau nutzbar sind. Bedacht wurde nur der Freilandgemüsebau, nicht der Unterglas-Anbau. Für diese SVLFG „Anpassungshilfe" waren keine Anträge zu stellen. Die SVLFG zahlt auf Basis der dort erfassten Flächen die Anpassungshilfen aus, jedoch seien offenbar einige Betriebe unberücksichtigt geblieben.
Kleinbeihilfen für die Unterglas-Produktion fallen unter die Zuständigkeit der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE). Auch von der BLE wurden offenbar einige Betriebe nicht angeschrieben. Angekündigt war eine automatische Weitergabe von der Berufsgenossenschaft SVLFG an die BLE. Die Ausschüttung soll zum 31. Dezember 2022 erfolgen. Viele beihilferechtliche Fragen seien noch nicht geklärt, so beispielsweise die Gaspreisbremse für industrielle Verbraucher. Die Obergrenze für landwirtschaftliche Betriebe wurde im Juli 2022 auf 62.000 € angehoben und soll nochmals angehoben werden auf 93.000 €. Für den gewerblichen Bereich wurde der Höchstbetrag auf 750.000 € festgelegt.
Barrierefreiheits-Menü
Schriftgröße
Kontrast
Menü sichtbar
Einstellungen









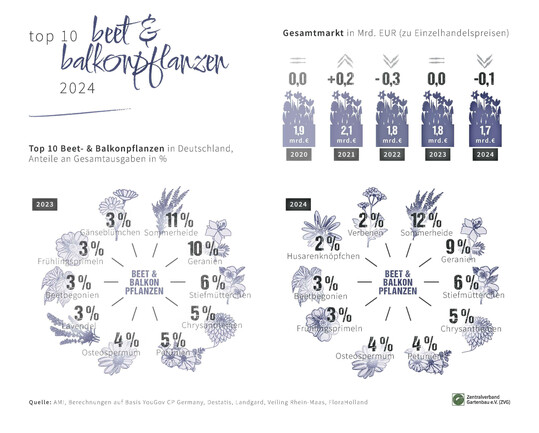





Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.
Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.